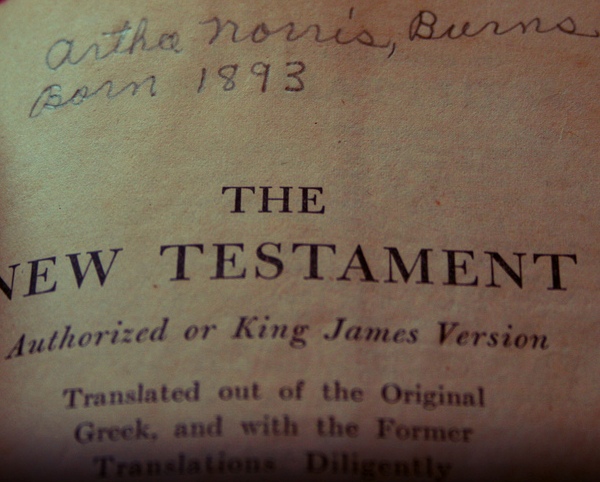Wie es wäre, in einer Welt zu leben, die keinen Tod kennt, beschreibt José Saramago in seinem Buch «Eine Zeit ohne Tod». Das Buch ist äusserst empfehlenswert, gerade auch dann, wenn man sich – wie so viele Menschen in unseren Breitengraden – ewig zu leben wünscht. Dass die Resultate, die bei diesem Experiment herauskommen würden, alles andere als erfreulich sind, zeigen die anekdotischen Gedanken. Mehr dazu aber in meinerBesprechung des Buches bei Tink.ch.
Von der Lektüre dieses Buches zurückgekehrt in die normale Welt, gilt es, schon wieder die Koffer packen und diesmal statt auf eine Gedankenreise, selbst einen Weg unter die Füsse zu nehmen. Auch dieser Weg soll nicht ohne Bücher gemacht werden, es wäre ja schade, wenn man mit dieser Reise nicht irgendwelche Lektüren in Verbindung bringen könnte.
Eines der Begleiter soll Shakespeares «Ein Sommernachtstraum» sein, von dessen Aufführung im Pfauen ich hellbegeistert war, vor allem von den Bauchrednerpuppen. Erstaunt war ich vor allem über die schlechten Rezensionen in einigen Feuilletons und anderen Magazinen, aber vielleicht werde ich auch noch nachträglich enttäuscht sein, wenn ich das nette Reclam-Büchlein gelesen haben werde.
Ausserdem soll auch Stefan Zweigs «Die Welt von Gestern» mitkommen. Dass ich beide Bücher lesen werde, glaube ich kaum, aber es ist immer schön zu wissen, etwas für den Fall der Fälle dabeizuhaben. Wahrscheinlich kommt es ja wieder so heraus wie im Sommer in den Segelferien, dass ich im Zug lieber die Augen zudrücke (hätten die Kondukteure bei den Leuten, die gestern kein Anschlussbillet für eine Zone hatten übrigens auch tun können!) oder mit den Mitreisenden gute Unterhaltungen führen.
Meinen Lesern und Leserinnen wünsche ich ganz schöne Ostern. Die Kommentarfunktion wird nur eingeschränkt verfügbar sein, dies um einerseits Spam, anderseits aber auch anderen Kommentaren, die nicht den Umgangsformen entsprechen, die in einer zivilisierten Gesellschaft erwünscht sind, vorzubeugen. Ich bitte, die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen!