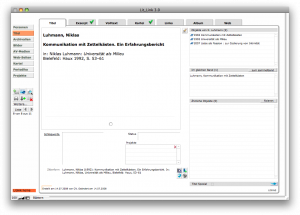Wer sich gelegentlich Zitate aus Gelesenem notiert und die Notizen gerne weiterverwenden möchte, stösst analog schnell an seine Grenzen. Gedanken zu Zettelkästen und digitalen Zettelkästen weitergedacht.
Elektronische Weichware statt brüchiges Papier
Wenn man sich doch gleich von Anfang an für eine Software begeistern und entscheiden könnte, hätte man am Schluss nicht die doppelte Arbeit. Zuerst hatte ich ja gedacht, dass ich Zitate beim Lesen auf physischen Zetteln sammeln würde. Da habe ich ja auch noch ein Plädoyer für das gute alte Papier geschrieben. Zurückziehen soll man solche Plädoyers nicht, denn sie haben immer noch einen Punkt, der nicht vernachlässigt werden will: Das Suchen und zufällige Finden eines Zettels, den man gar nicht gesucht hätte, indem man blättert, geht mit der elektronischen Verschlagwortung verloren. Ein Nachteil, den man wohl verschmerzen mag, wenn man die Vorteile eines elektronischen Zettelkastens sieht.
Digitaler Datensalat
Ein grosses Problem hat ein analoger, also papierner Zettelkasten, schnell einmal mit digitalen Daten, die sich auf unseren Festplatten in immer grösseren Mengen anhäufen: Hier ein Schnipsel eines Musikstücks als mp3, da ein Bild, das man elektronisch gefunden hat, dort ein Digitalisat eines Films, den man auf Youtube heruntergeladen hat, sprich ein Haufen an verschiedenen Formaten, die alle an einen Ort gepresst werden wollen. Bilder könnte man ja immerhin noch ausdrucken, solange sie Schwarz-Weiss sind, kein Problem in meinem Fall; sobald es aber farbige Bilder sind heisst es zum nächsten Copyshop rennen, denn der Laserdrucker vermag es nicht, farbige Bilder aus sich heraus zu zaubern.
Multimedial organisiert
Über Musikstücke soll man den händisch angelegten Zettelkasten gar nicht ausfragen, was soll der mit einem mp3-File anfangen? Der geübte Musikus könnte sich Akkordreihenfolgen notieren oder gar ganze Partituren vom gehörten Material anfertigen, aber wie denn solche Informationen in einen Index einarbeiten? Mit viel Phantasie würde man sich ein Ordnungssystem aneignen, das einem im nächsten Moment wie eine Unordnung vorkommt: Die Akkorde sind irgendwo aufgeschrieben, die Partituren irgendwo gelagert, bloss wo?
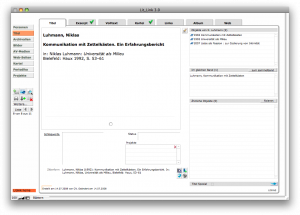
Screenshot: Litlink organisiert die Buchdaten, Exzerpte und Kommentare.
Elektronisch: Karteikasten für den kleinen Ordnungshelden
Und da sind wir denn auch schon beim springenden Punkt, der den Karteikasten aus dem Rennen ausscheiden lässt: der Index will fein-säuberlich nachgeführt sein, Stichworte kontrolliert und die Karten an der richtigen Stelle im System eingeordnet sein. Wer dabei nicht der grosse Ordnungsheld ist, hat das Spiel schnell verloren, wenn er denn eine einigermassen grosse Zahl an Zitaten beisammen hat. Dies natürlich auf Zetteln, die alle gleich aussehen, sich nur durch die Dinge unterscheiden lassen, die ins Papier eingeprägt sind. Kommt da mal etwas ein bisschen durcheinander, vertauscht beispielsweise Zettel 35/5a seinen Platz mit Zettel 27/3c und kommt ein Windstoss, der Zufallsgenerator spielt, so ist die ganze Arbeit schnell verloren oder ein grosser Stapel Arbeit wartet darauf, vollbracht zu werden: Eine Woche lang würde dann auf der Pendenzenliste stehen, dass der Karteikasten eine Sortierung benötige.
Automatische Sortierung und Bibliografie-Stile nach Strickmuster
Diese Sortierung übernimmt Litlink automatisch. Man braucht lediglich Schlagwörter anzugeben, kann Notizen und Zitate den Buch- und Personeneinträgen zuordnen, wobei diese miteinander verlinkt werden. Sucht man nun nach einem bestimmten Schlagwort, kann man immer noch auf zufällige Dinge stossen, recherchiert man gründlich in der Kartei, kann man sogar Gedanken finden, von denen man gar nicht mehr weiss, dass man sie je einmal gehabt hatte. Und der grösste Vorteil: Es lassen sich verschiedene Bibliografie-Stile einrichten, mit denen man die Ausgabe von Bibliografien automatisieren kann und je nach Anforderung anpassen kann, ohne mühsam jeden Eintrag manuell abzuändern.
Der steinige Weg zur digitalen Sammlung
Bis man allerdings alles in seiner digitalen Form hat, vergeht eine gewisse Zeit. Die Monografien, Sammelbände und Aufsätze wollen zuerst aus irgendeinem Bibliothekskatalog importiert und mit den eigenen Bemerkungen annotiert sein, dann erst hilft einem die Datenbank etwas. Funktioniert einmal alles, soll man von einer tollen Gedächtnisstütze profitieren können. Ganz nach dem Luhmannschen Zettelkasten, mit dem man sogar kommunizieren könne.
Literaturhinweise und Download-Links:
[1] Alte Gedanken zu Zettelkästen: 19.8.2007: Zettelkasten oder Tags?; 1.5.2008: Lieber Zettelkasten statt Tags.
[2] Lit-Link: Zettelkasten-System, das auf einer Filemaker-Datenbank basiert. Wird an der Universität Zürich entwickelt und stetig verbessert.
[3] Luhmann, Niklas (1992): Kommunikation mit Zettelkästen. Ein Erfahrungsbericht. In: Derselbe: Universität als Milieu, Bielefeld: Haux, 53–61.